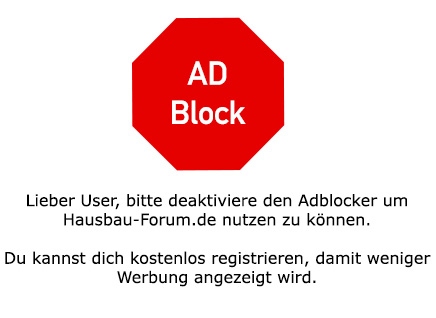11ant
Ich bin "nur" Bauberater, kein Statiker. Und der TE ist ja bereits von der Vernunft überzeugt. Aber für ihn und die Mitlesenden führe ich es gerne dennoch näher aus:
Oder auf die Sprache Eures Zimmermanns übersetzt: schon damals hat man gerne mit zwar viel, aber eben nicht noch mehr (und dann unnötig viel) Holz gearbeitet.
Die Aufgabe der Zangen ist hier, das Wegscheren der Sparren in Richtung der Traufen zu unterbinden, indem sie mit den Sparren beider Seiten ein stabiles Dreieck bilden. Da sie das aus der Achse der Sparren versetzt sind, müssen sie dies in geteilter Stärke von beiden Seiten tun. Sie sind gewissermaßen eine parallel nach oben verschobene Basis des Dreiecks (vermutlich wegen der Verwendung einer Betondecke). Alternativ hätte man das Dreieck auch so aufbauen können, als Basis Deckenbalken des darunterliegenden Stockwerks gleichzeitig als Untergurte zu verwenden. Wie die Kräfte eines Dachstuhls zueinander wirken, hat auch mit ihren geometrisch-physikalischen Verhältnissen zu tun. Hier liegt ja offensichtlich ein für diese Dachstuhlbauweise grenzwertig flach geneigtes Satteldach (um 30° oder leicht darunter) vor, und ein eher als Trockenboden / Abstellraum gedachter Dachraum, in dem sich keine Zwischenwände dafür anboten, Stützen der Pfetten in sie zu integrieren. Nun könnt Ihr es auch Eurem Zimmermannslehrling erklären.
Nein, nicht irgendeine - sondern, daß der Dachstuhl zusammenkracht.Besteht irgend eine Gefahr beim Verzicht auf diese doppelte Zangen?
Der möge bitte umschulen, in seinem Beruf sollte er es wissen (und sogar besser erklären können als ich).Unser Zimmermann sagt uns, dass damals "gerne mit viel Holz" gearbeitet wurde...
Hosenträger zum Gürtel - aber in einer Konstellation, in der beide benötigt werden.ob das Hosenträger zum Gürtel sind. Was ich fast befürchte.
Irgen etwas hat man sich damals dabei gedacht den Aufwand zu betreiben. Ein Statiker kann das nachrechnen
Dreimal richtig: 1. etwas dabei gedacht, 2. statisch notwendig, und 3. ersetzbar. Und zwar meiner Ansicht nach durch Stützen mindestens unter den Mittelpfetten, die allerdings dann ebenfalls mit (längeren) Zangen zu verbinden wären, und Lasten in die darunterliegende Decke ableiten würden.Die Teile heißen auch Firstlaschen und sind ein statisch notwendiges Element. Die Suchmaschine des Vertrauens sagt dazu: Sie dient der Aussteifung der Sparren, um Zug- und Druckkräfte der Sparren aufzunehmen.
Vielleicht gibt es Alternativen. Das kann dir ein Statiker oder Zimmermann sagen. Einfach entfernen würde ich sie nicht.
Oder auf die Sprache Eures Zimmermanns übersetzt: schon damals hat man gerne mit zwar viel, aber eben nicht noch mehr (und dann unnötig viel) Holz gearbeitet.
Gäbe es einen Kraftschluss zwischen ihnen und der Firstpfette, wäre das gar ein statischer Kurzschluss.Die Firstpfette ist gar nicht auf den Zangen unterstützt. Die Zangen verbinden lediglich die Sparren paarweise.
Die Aufgabe der Zangen ist hier, das Wegscheren der Sparren in Richtung der Traufen zu unterbinden, indem sie mit den Sparren beider Seiten ein stabiles Dreieck bilden. Da sie das aus der Achse der Sparren versetzt sind, müssen sie dies in geteilter Stärke von beiden Seiten tun. Sie sind gewissermaßen eine parallel nach oben verschobene Basis des Dreiecks (vermutlich wegen der Verwendung einer Betondecke). Alternativ hätte man das Dreieck auch so aufbauen können, als Basis Deckenbalken des darunterliegenden Stockwerks gleichzeitig als Untergurte zu verwenden. Wie die Kräfte eines Dachstuhls zueinander wirken, hat auch mit ihren geometrisch-physikalischen Verhältnissen zu tun. Hier liegt ja offensichtlich ein für diese Dachstuhlbauweise grenzwertig flach geneigtes Satteldach (um 30° oder leicht darunter) vor, und ein eher als Trockenboden / Abstellraum gedachter Dachraum, in dem sich keine Zwischenwände dafür anboten, Stützen der Pfetten in sie zu integrieren. Nun könnt Ihr es auch Eurem Zimmermannslehrling erklären.
Als Hilfe für den Deckenbau hätten in vergleichbarer Position (aber nicht paarweise benötigt) Kanthölzer genügt. Ich empfehle Euch, die Dachschrägen auf ganzer Länge der Sparren durchzudämmen - also auch über die Zangen hinaus und hinter eventuell noch abzudrempelnden Abseiten - denn so ist es thermisch sauberer. Die Pfriemelei des Verkleidens um die Zangen herum dürfte mit der Alternative eine Decke unter ihnen einzuziehen in etwa gehupft wie gesprungen sein (Pest oder Cholera, zeitaufwendig und ineffizient im Vergleich zu den großen Flächen wird beides). Aber thermisch vermeidet ihr dadurch einen Kalthohlraum zwischen Zangen und First. Eine Decke einzuziehen und mit Dämmung zu belegen, würde im Tausch gegen nicht wirklich lohnend eingesparte Dämmrollenlänge nochmals mehr Fummelei-Tagewerke bedeuten.oder dienen diese nur als Hilfe für den Deckenbau? Heute fragen wir uns, ob wir nicht auf die Zangen verzichten und die Dachschrägen bis zur Firstpfette laufen lassen.